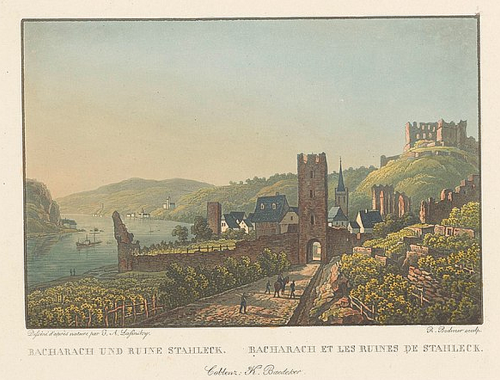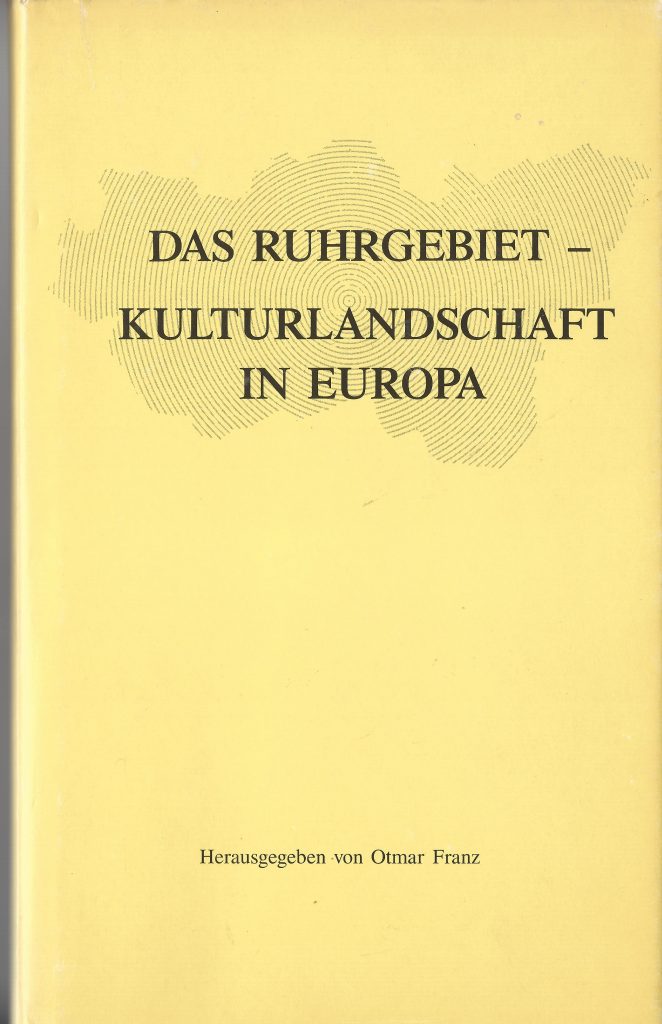Museen und Kultureinrichtungen – Bedrohte Produktionsstätten?
EDIT Februar 2021:
Vielleicht lohnt ein Blick in dieses Buch gerade in Zeiten von Corona-Pandemie und Lockdown noch einmal besonders.
Und wieder einmal ein Fund aus meinem Bücherregal:
Es ist ein kleines dünnes Büchlein, vollkommen unscheinbar kommt es daher und man sieht ihm die Jahre an in die es inzwischen gekommen ist. Als ich es in die Hand nahm, da erwartete ich darin Informationen über einige Denkmäler im Ruhrgebiet zu finden, ein wenig über die Geschichte dieser Region. Weit gefehlt – es ist eine Aufsatzsammlung in der (wie der Klappentext verrät):
„Führende Kulturpolitiker, Künstler und Wissenschaftler des Ruhrgebiets […] in ihren Beiträgen die kulturelle Vielfalt und die historische Dimension dieser Region [dokumentieren], aber auch die Bedeutung der Kultur für die wirtschaftliche Entwicklung des Reviers und den Sinn der Unterstützung der Kulturarbeit des Ruhrgebiets.“
Na denn, das Thema scheint wichtiger als je zuvor in Zeiten in denen für Kultur kein Geld mehr ausgegeben wird und Hugendubel die Bibliotheken erobert.
Was also hat man vor fast 30 Jahren über dieses Thema so gesagt und gedacht und geschrieben? Ist Vieles besser oder eher schlechter geworden?
Ich fange mal an zu lesen:
Otto Krabs und das Museum als Produktionsstätte
Als erster Aufsatz fällt mir der von Otto Krabs ins Auge, der damals Kreisdirektor und Kulturdezernent des Kreises Unna war:
Otto Krabs: Ökonomische Bedeutung von Kunstmuseen im Ruhrgebiet, in: Das Ruhrgebiet – Kulturlandschaft in Europa, hg. v. Otmar Franz, Duisburg 1990, S. 178-182, hier S. 182:
Kulturelle Einrichtungen können als Produktionsstätten betrachtet werden, die zahlreiche externe Effekte auslösen und es wäre mehr als wünschenswert, wenn dieser Sachverhalt von der Politik, von der Wirtschaft, von der Administration akzeptiert und in konkretes Handeln, besser in konkludentes Handeln umgesetzt würde.
Bravo, möchte man rufen! Doch 28 Jahre später ist dieser Gedanke offenbar immer noch nicht in den Köpfen der Verantwortlichen angekommen.
Norbert Lammert über “High Tech” und “Low culture”
Der nächste Aufsatz, der mir ins Auge fällt stammt von Norbert Lammert, damals MdB, Vorsitzender der CDU des Ruhrgebiets und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft:
Norbert Lammert: Die Bedeutung der Kultur für die wirtschaftliche Entwicklung des Reviers, in: s.o., S. 159-167, hier S. 159:
Und die Bedrohung der Kulturlandschaft gefährdet ganz sicher wiederum die wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven dieser Region.
und S. 161
„HighTech“ und „Low culture“, das geht mit Sicherheit nicht zusammen.
weiter S. 166
Deswegen denke ich, müßte auch die ständige Rede von Subventionen für Kunst und Kultur Anlaß sein, Fragezeichen hinter das Selbstverständnis einer Gesellschaft zu setzen, die den Investitionsbegriff ausschließlich für betriebs- und volkswirtschaftliche Sachverhalte reklamiert. Wieso eigentlich sind Ausgaben für Kultur Subventionen und Ausgaben für die Zukunft von Arbeitsplätzen Investitionen?
Ich klatsche innerlich Beifall und frage mich weiter warum diesen schönen Worten seit Jahren keine adäquaten Taten folgen.

Michael Fehr über gesellschaftliche Krisen und einen Vorschlag
Der letzte Beitrag, der mich zum Nachdenken bringt stammt von Michael Fehr, dem damaligen Leiter des Karl-Ernst-Osthaus-Museums in Hagen:
Michael Fehr: Museumslandschaft Ruhrgebiet – eine Skizze, in: s.o., S. 51-58, hier S. 51:
Die meisten Menschen neigen dazu, Museen und ihre Inhalte mit Tradition gleichzusetzen. Diese Einschätzung liegt nahe, da in der Mehrzahl der Museen historische Objekte aufbewahrt werden. Tatsächlich steht die Entwicklung des Museumswesens jedoch in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Schwinden von Tradition und Traditionsbewußtsein: Erfunden im Zuge der Aufklärung, entwickelte sich das moderne Museumswesen mit dem Aufkommen der Industrialisierung und wurde im 20. Jahrhundert zu der womöglich wichtigsten Kulturinstitution der modernen Industriegesellschaft.
Er erläuterte, dass 4/5 der 2.500 Museen in Deutschland nach 1900 gegründet worden sind und
daß gesellschaftliche Krisen diese Entwicklung nicht aufhalten konnten. Vielmehr läßt sich – etwas überspitzt – behaupten, daß gesellschaftliche oder ökonomische Umbrüche häufig geradezu die Voraussetzung für die Entstehung neuer Museen bzw. neuer Museumstypen waren. Insoweit reflektieren Museumsgründungen das gesellschaftliche Bewußtsein in bestimmten historischen Epochen oder genauer: dasjenige der darin dominierenden gesellschaftlichen Gruppierungen.
Eine Erklärung dafür, warum gerade jetzt so viel Bewegung in der Museums- und Kulturlandschaft herrscht.
Auf S. 53 übt Fehr Kritik daran, dass Museen zunehmend weniger Wissenschaft betreiben und immer mehr nur aufs Präsentieren verlegt werden. Ein Trend, der heute in Zeiten von Instagram, Pinterest, Youtube und Co. noch viel stärker ist als in jenen jahren:
Diese Problematik berührt den womöglich wichtigsten Aspekt der Krise, die hier skizziert wird. Er resultiert aus der Verbreitung der elektronischen Medien bzw. der Datenverarbeitung; sie macht auch vor den Museen nicht halt. Vielmehr werden viele Museen – durchaus in bester Absicht – zur Lösung der oben angeschnittenen Probleme den Maßstäben der neuen Medien unterworfen und entsprechend umorganisiert. Zur Disposition steht damit erstmals die spezifisch museale, die objektbezogene und objektgebundene Erkenntnisform. Ihre eigentümliche Leistungsfähigkeit wird Rezeptionsformen geopfert, die an den neuen Medien – allen voran dem Fernsehen – ausgebildet sind: dem Bedürfnis nach einfacher, eindeutiger, ohne Voraussetzungen verständlicher und unterhaltsamer Information.
Auf S. 54 heißt es weiter:
Kurz gesagt. Beziehen die Museen ihre Reputation vor allem aus der Tatsache, daß sie als wissenschaftliche Einrichtungen gelten, also von wissenschaftlichem Personal nach objektivierbaren Gesichtspunkten geführt werde, so ist festzuhalten, daß sie aus den angedeuteten Gründen als wissenschaftliche Einrichtungen tendenziell an Bedeutung verlieren und zunehmend mehr als bloße Medien der Wissensvermittlung, wenn nicht nur noch als Rahmen für private Investments betrieben werden. Gerade, wenn man in dieser Tendenz kein gänzlich neues, sondern ein den Museen schon immer inhärentes, gegenwertig lediglich stärker akzentuiertes Moment erkennen will, ist bemerkenswert, daß entsprechende Reflexionen nur in Einzelfällen, und dann fast immer nur als Fragestellung der Museumspädagogik angestellt werden.
Besonders interessant finde ich den Vorschlag, den Fehr auf S. 58 präsentiert:
… es ist das Projekt eines „Museums der Geschichte und Kultur der Arbeitsemigranten“. Ein solches Museum nähme das für das Ruhrgebiet prägende Phänomen der im 19. Jahrhundert einsetzenden Arbeitskräftewanderungen zum Anlaß, die Lebensformen in der industrialisierten Gesellschaft zu untersuchen. Methodische Zielvorstellung ist dabei, daß über die Auseinandersetzung mit dem jeweils Fremden, das mit den zugewanderten Menschen ins Revier kam, und ihren Schwierigkeiten, in der bestehenden Gesellschaft Fuß zu fassen, ein Bild des Alltags bzw. seiner Veränderungen gewonnen werden könnte. Weiterhin hätte ein solches Museum zu rekonstruieren, welche Umstände die Menschen eigentlich veranlaßten, ihre Heimatländer zu verlassen. Es müßte den Rückwirkungen des Migrationsprozesses nachgehen. Schließlich wäre dieses Museum als Ort zu konzipieren, der den Kulturen der Arbeitsemigranten, soweit sie sich in eigenständigen Formen erhalten haben oder rekonstruierbar sind, einen Platz und Entwicklungsmöglichkeiten böte. Es liegt auf der Hand, daß ein solches Projekt nur als interdisziplinäre, mit wissenschaftlichen wie künstlerischen Methoden arbeitende Einrichtung gedacht werden kann und zu seiner Verwirklichung weniger große finanzielle Aufwendungen als vielmehr ein hohes Maß an Phantasie und Experimentierbereitschaft, Mut und Langmut möglicher Träger notwendig wäre.
Fast 30 Jahre ist das Büchlein alt und an vielen Stellen einfach brandaktuell.
(So viel übrigens zum grandiosen Berliner Vorschlag die Bücher, die mehr als zwei Jahre nicht ausgeliehen wurden zu schreddern. Dem Vorschlag folgend wären mir diese Gedanken und Ideen wohl verloren gegangen.)

Kultur-News KW 09-2018
Zettelkasten #20
Das könnte dich auch interessieren

Kultur-News KW 37-2022
18. September 2022
“Das Kaiserreich vermitteln” – ein wichtiger Tagungsband
3. Oktober 2022